
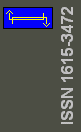

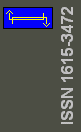
Es wird über das 7. Internationale Meeting vom 4.-11.März auf La Gomera (Kanarische Inseln) berichtet, auf dem sich aus vier Nationen über 20 Entomologen in der Biologischen Station des Curculio Instituts („Casa Diversa“) in Hermigua trafen. Die Referate der Gastredner von den Kanaren werden zusammenfassen dargestellt und die Ergebnisse der zahlreichen Exkursionen vorgestellt. Seit der Veröffentlichung des letzten La Gomera-Katalogs zu den Rüsselkäfern im Dezember 2012 (SNUDEBILLER) konnten auf diesem Treffen 4 weitere Arten als neu für La Gomera gemeldet werden. Von den neuen Arten werden Habitus- und Aedoeagus-Aufnahmen, Verbreitungskarten und Fundumstände vorgestellt. Die Zahl der validen Rüsselkäfer-Taxa beläuft sich heute auf 125 Spezies. Neue Erstbeschreibungen sind in Vorbereitung.
A report is given on the 7th International Meeting on La Gomera (Canarian Islands) from 4.-11. March. More than 20 entomologists from four nations met in the Biological Research Station of the Curculio Institute (“Casa Diversa“) in Hermigua. The lectures of the guest speakers from the Canaries and the results of the numerous excursions are presented. Since the publication of the recent La Gomera catalogue on weevils in December 2012 (SNUDEBILLER), 4 additional species were recorded for the first time on La Gomera during this meeting. Habitus and aedeagus photos, distribution maps and finding circumstances of the new species are presented. Now there are 125 valid weevil species known from the island and first descriptions are being prepared for several additional species.
Meeting, Entomologists, Curculio Institute, Curculionoidea, Curculionidae, new records, Spain, Canary Islands, La Gomera.
Als nach vielen Monaten der Vorbereitung am 18. Dezember 2010 die erste Biologische Station des CURCULIO-Instituts feierlich auf La Gomera eröffnet wurde [Fig. 76.1][Stüben 2011a,b], stand schnell fest, dass genau hier das nächste, 7. Internationale Meeting des CURCULIO-Instituts stattfinden würde [Fig. 76.2].
Die Voraussetzungen waren geradezu ideal. Mit einem eigenen kleinen Labor und einem ersten Exkursions-Jeep [Fig. 76.3], den idealen Übernachtungsmöglichkeiten in der Casa Diversa unseres Counterparts in Hermigua (Las Nuevitas) [Fig. 76.4] und einer für diese Idee schnell zu begeisternden Bürgermeisterin von Hermigua liefen die Vorbereitungen bereits 2010 an. So konnten wir uns von Anfang an der Unterstützung des Cabildos von La Gomera (San Sebastian) ebenso sicher sein wie der der Leitung des berühmten Garajonay-Nationalparks. Beide Institutionen stellten uns die notwendigen Genehmigungen aus, um auf La Gomera Curculionidae sammeln zu dürfen und trugen so auf ihre Weise zum Gelingen der Veranstaltungen vom 4.-11. März 2012 in Hermigua bei.
Schon im Dezember 2011 war eine Vorabdelegation angereist, um eigens die für diese Veranstaltung gedruckten Plakate in ganz La Gomera aufzuhängen [Fig. 76.5]. Wenige Tage vor der Eröffnung des Internationalen Meetings trafen Anfang März 2012 die ersten Kollegen aus Deutschland ein. Sie hatten schon Wochen vorher im Norden Tenerifes für den geplanten Makaronesien-Katalog Rüsselkäfer gesammelt, dessen erster Teil „Die Curculionoidea La Gomeras“ bereits am 1. Dezember 2011 im SNUDEBILLER 12 erschienen war [Stüben 2011c] [Fig. 76.6].
Insofern war die Datenbasis mit 29 Erstnachweisen für La Gomera schon gelegt (Korrekturen zum La Gomera-Katalog: siehe Anhang 1). So konnten die in den Tagen danach eintreffenden Kollegen aus Frankreich [Fig. 76.7], Tschechien [Fig. 76.8], Spanien [Fig. 76.9] und Deutschland [Fig. 76.10] gleich mit den notwendigen Informationen zu den Arten, Fundorten und Fundumständen ausgestattet werden. Dafür hatte eigens Alexandre Stüben ein großes DIN A1-Poster mit den zu diesem Zeitpunkt 121 bekannten Rüsselkäfer von La Gomera entworfen [Fig. 76.11] (siehe Anhang 2). Die Bereitstellung dieser Informationen und einer fast vollständigen Vergleichssammlung zu den Curculionoidea von La Gomera hatten den unschätzbaren Vorteil, dass von nun an auf La Gomera nicht nur in Kleingruppen biotop- und umweltschonend gesammelt werden konnte, sondern allabendlich an den bereitgestellten Mikroskopen ein sofortiger Abgleich mit den Arten in der bestehenden Sammlung der Biologischen Station erfolgen konnte [Fig. 76.12].
Neben der regen Sammeltätigkeit in der Zeit vom 4.-11. März 2012 fanden auf dem Hauptplatz in Hermigua in einem dankenswerterweise vom Ayuntamiento bereitgestellten Zelt mit Bühne, Lautsprecher und Beamer, an drei Abenden zentrale Veranstaltungen statt [Fig. 76.13]. Als Tagungssprache wurde bewusst Spanisch gewählt, um möglichste vielen Interessenten aus der heimischen Natur-, Arten- und Umweltschutzbewegung eine Teilnahme zu ermöglichen (gelegentlich wurden die wichtigsten Thesen aber auch ins Englische oder Deutsche übersetzt).
Gleich nach der Eröffnung des 7. Internationalen Meeting am 4.3.2012 durch den 1. Vorstandvorsitzenden des CURCULIO-Instituts, Peter E. Stüben, und der Bürgermeisterin von Hermigua, Solveida Clemente, sprach Lázaro Sánchez Pinto vom Museo de Ciencias Naturales de Tenerife noch am Abend zum Thema: „Historia de la laurisilva canaria: el caso de La Gomera“ [Fig. 76.14]. Hier einige seiner Thesen aus der viel beachteten Rede:
„Prior to the European conquest of the Canaries (15th Century), the laurel forest or laurisilva covered vast areas of the central and western islands. Shortly after their arrival, the new settlers cleared much areas of this forest for agriculture, and as a source for firewood, charcoal and timber for construction, furniture, tillage tools and many other purposes. During the 16th Century, sugar became the most important export product of the Canaries, and the best soils in the lowlands were devoted to the cultivation of sugar cane. Its production required huge amounts of water and fuel, and both were obtained from the nearby laurel forest. The deforestation was so intensive that many natural springs dried up leading to water supply shortages. The authorities enforced several laws to prohibit logging under severe penalties, including the cutting off the right-hand thumb, but deforestation continued uncontrolled for many decades. Only a few tree stands located near the first settlements escaped this massive deforestation. They were found close to water springs, and many of them still survive today. In fact, the oldest living trees of the laurel forest are currently found in the vicinity of villages and not in remote mountains or deep ravines.
The extension of the laurel forest was further reduced after the 16th Century due to a continuous demand of timber to satisfy the local and export markets. La Gomera was an exception, because it was colonized by Feudal Landlords. They refused to give up their land privileges and preserved the forest as a private hunting reserve, with introduced red deer, wild boars and other game animals. Although feudal rights were abolished at the beginning of the 19th century, and thereafter the island suffered a great deforestation, the laurisilva of La Gomera is still the biggest and best preserved of the Canaries.
Currently, all the ecosystems belonging to the Canary laurel forest are protected by law, but they only cover less than 10% of its original area [Fig. 76.15]. This forest is highly fragmented in all the islands, with the exception of La Gomera. These fragments form a patchy landscape in which the forest remnants are usually very distant from each other. This biogeographical pattern has detrimental conservation implications.“
In den Tagen danach wurden diese Veranstaltungen immer wieder unterbrochen von ausführlichen Rundfunk- und Fernsehbeiträgen [TV Canarias]. Auch in der heimischen Presse fanden die Veranstaltungen ein ebenso lebhaftes Echo [Fig. 76.16] wie Informationen zum Wirkungs- und Tätigkeitsfeld des CURCULIO Instituts auf La Gomera. Die wohl am häufigsten gestellte Frage, warum das Institut mit weit über 100 Wissenschaftlern aus allen Ländern Europas gerade die kleine Kanareninsel La Gomera zum Sitz ihrer ersten Biologischen Station gewählt habe, soll hier gleich nochmals beantwortet werden: Keine Kanareninsel hat auch nur annähernd eine so hohe Biodiversität, und kein anderer Platz in Europa bietet mit so vielen Schutzgebieten und dem Garajonay-Nationalpark auf so engem Raum so ideale Forschungsbedingungen wie La Gomera. In den letzten 10 Jahren wurden fast jedes Jahr 2-3 neue Curculionidae von La Gomera beschrieben! Und last but not least sind es die kurzen Wege in praktisch jeden Biotoptyp, die das Forschen hier so angenehm machen: von den küstennahen Sukkulentenbuschformationen über die Reste der thermophilen Buschwälder bis in die immergrünen subtropischen Zonen des Laurisilva.
Es ist genau dieser einzigartige, „mythische“ Wald [Fig. 76.17], der mit seinen mächtigen Bäumen etwa bei „Las Mimbreras“ oder „La Mesata“ nicht nur jedes Jahr für viele Tausend Besucher und Naturfreunde zu einem Anziehungspunkt geworden ist, sondern der auch jeden Wissenschaftler immer wieder erneut ins Staunen versetzt [Fig. 76.18] [Stüben et al. 2010]. Für den Direktor des Garajonay Nationalparks, Ángel Fernández López [Fig. 76.19], war das Ansporn und Herausforderung zugleich, diesen Wald in seinem Vortrag ‚Renaturierung und Schutz der Wälder La Gomeras’ mit der allerhöchsten Priorität zu versehen. Hier einige zusammenfassende Gedanken aus seinem am 7. März 2012 gehaltenen Vortrag: „El Parque National de Garajonay: valores y gestíon“.
„At a short distance from the Saharan desert coast, along the summits of the Canary island of La Gomera, is found one of the most singular forests of Spain, the Garajonay National Park, listed as a World Heritage Site by UNESCO in the Natural Category. The persistent clouds and fog that frequently cover these mountains favour the survival of these ancient and splendid subtropical forests, known under the name of Canary Laurisilva or Canary laurel forest. This ecosystem is a relic from the Tertiary Age, extinct in the continent because of the climatic changes that occurred in the Quaternary. It is a natural refuge with an extraordinary number of endemic and endangered species. Nowadays, Garajonay National Park, with almost 4000 ha, is the best preserved remnant of this ecosystem.
The main aims of the management plan are:
Implementation of a management model based on a non intervention approach, to allow ecosystem naturalization. The monitoring program that is being implemented shows important changes in the composition and structure of the forest. This experience is of high interest, a real reference in forest naturalization processes.
Implementation of an important ecological restoration program in the degraded areas of the Park, affected by plantations of alien fast growth commercial forest species introduced in the 1960s, which initially covered about 15% of the Park [Fig. 76.20]. This successful program has, as a main aim, the restoration of the native forest, with 80% of its objectives archieved so far. This program is a reference point in ecological restoration in Spain.
The conservation of endangered flora is one of the main challenges for the Park management because of the high number of taxa included in the Red Lists. At the present moment the Park is working with about 20 endangered species, and 11 recovery plans are already available. These programs have served to improve the situation of many populations and are considered a pioneer experience in Spain since they began to be implemented in the eighties.“
Entomologie aber hat immer auch eine ganz persönliche Seite und die hat oft etwas mit Leidenschaft und – wie in dem folgenden Fall – mitreißender Begeisterung zu tun. Antonio Machado Carillo (Tenerife) konnte in wenigen Jahren die Artenzahl der Laparocerus von einst 130 Taxa auf jetzt fast 200 Taxa heraufschrauben – und ein Ende scheint nicht absehbar. Sein Vortrag „Como se estudian las especies? Los gorgojos, récord de biodiversidad en Canarias“ (9. März 2012) bleibt uns ebenso unvergessen wie die vielen gemeinsamen Exkursionen, die uns zu nachtaktiven Entomologen auf der Suche nach nachtaktiven Insekten auf den Kanaren haben werden lassen
[Fig. 76.21]. Und weil es so schön war
[Fig. 76.22], habe ich ihn nochmals gebeten, eigens für diesen Report seine Motive, sich ganz den Laparocerus verschrieben zu haben, darzustellen:
„Why Laparocerus?
by A. Machado
In 1992, I concluded a fifteen-year extensive study of the ground-beetle fauna of the Canary Islands. Obviously, my interest in beetles and island evolution was not exhausted, but spurred on. Thus, I looked for another group of insects where speciation and eventual evolution patterns could be studied in more depth and coherently. I designed the profile of the ideal candidate: preferably a species-rich genus, with all species being flightless, present in as many islands and habitats as possible, and the whole set be monophyletic. No doubt, oceanic islands would be the place to look for it.
A few candidates were available (Tarphius, Cardiophorus, Hegeter, etc.) but Laparocerus was clearly the best option. No other genus had so many species ascribed to it, and all of them being endemic to Macaronesia. Some 130 species-level taxa were known from the Azores, Madeira, Selvagens, and the Canaries, plus one species from the Macaronesian enclave in North Africa. Each island, inhabited by several species ─ mostly monoinsular endemics ─, represents a repeated evolutionary experiment of nature. Just perfect! The problem: Laparocerus were poorly known, not revised taxonomically, extremely variable, and difficult to find in the field; just a potential nightmare that my colleagues termed a masochist endeavour. Conversely, I found them a wonderful challenge!
My first gratification was to find that Laparocerus were rare in collections, but not in nature, at least, during the night [Fig. 76.23]. Being nocturnal, these weevils hide underground during the day and that is why by-catches were so uncommon. At night they come out to feed in hundreds! Needless to say that I became a compulsive nocturnal entomologist, discovering that insect life is much fun when it is dark.
I initiated a strategic field prospection throughout all Macaronesia, a complete taxonomic revision and a phylogenetic study based on mitochondrial DNA data. My professional duties did not allow me to dedicate myself full time to the Laparocerus study, but after thirteen years of spattered dedication and over 30.000 specimens studied, the overall picture is getting sharper. Laparocerus species have increased to nearly 200 taxa, an absolute record of biodiversity in Macaronesia. I established several synonyms and some important changes have been fixed or are still in the pipeline. Species from the Azores, for instance, belong to a different independent genus; others, like those included in the genus Lichenophagus, Anillobius or Cyphoscelis, are Laparocerus. The Madeira and Afro-Canarian clades are both monophyletic, and it is not yet clear to me if all the subclades (several subgenera) have formed within the archipelagos or split originally in Africa before their invasion took place. I hope to be able to tune up the molecular clock specifically for this group in this region, and solve that question. The divergence in forms is astonishing and the many cases involved will allow the use of statistics to reveal hidden patterns.
My aim with this study is to establish the basis for future spatial evolutionary studies, and if I would be a politician, I would promise that Laparocerus will take Darwin finches out of the podium.”
Einen weiteren Höhepunkt bildete am 9. März 2012 die Einladung des Ayuntamiento an die Teilnehmer des CURCULIO-Meetings und an viele Interessenten aus Hermigua zu einem warmen Buffet, zu dem das Cabildo La Gomeras den viel beachteten Garajonay-Wein beisteuerte [Fig. 76.24]. Der gesamte Vorstand des CURCULIO-Instituts und die Teilnehmer des Meetings dürfen sich an dieser Stelle nochmals herzlich für das große Interesse und die Aufgeschlossenheit, die außergewöhnliche Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft bei der Administration und den politisch Verantwortlichen auf La Gomera und in Hermigua bedanken.
Es ist schon etwas Besonderes und verrät eine hohe Sensibilisierung für den Arten- und Naturschutz auf La Gomera, dass die Schulkinder in den Monaten danach in Hermigua zusammen mit ihren Lehrern den erst 2007 auf ihrer Insel entdeckten Laparocerus hupalupa in ‚Überlebensgröße’ auf ihr Schulgebäude malten. Es ist aber auch seit Jahren schon ein Kernanliegen des CURCULIO Instituts, vor allem junge Menschen mit dem notwendigen Wissen auszustatten, um die einzigartige Natur, hier ihre Heimat auf La Gomera, wahrzunehmen und nachhaltig zu schützen: Denn wir können nur das schützen, was wir kennen und lieben! [Fig. 76.26]
Und tatsächlich werden auch wir, Wissenschaftler und Sammler, immer wieder von dem Umstand überrascht, dass wir eben vieles noch nicht kennen. Zwar waren die klimatischen Bedingungen auf La Gomera noch Anfang März 2012 viel zu trocken - hatte es doch seit dem Sommer 2011 praktisch nicht mehr geregnet -, so gab es dennoch auf den zahlreichen Exkursionen während des Meetings einige Erstnachweise und Besonderheiten für La Gomera zu vermelden (*):
HABITUS: [Fig. 76.27]
KANARISCHE INSELN (Lista/2009): La Palma - Tenerife - Gran Canaria
LA GOMERA: [Fig. 76.28]
9 Ex.: Hermigua, Chenopodium murale L., 28°10'4"N 17°11'36"W, 86 m, 9.3.2012, leg. Sprick, Stüben, Bayer
HABITAT: [Fig. 76.29]
Kommentar: Morrone meldet die Art aus folgenden Regionen: Argentinien, Australien (eingeschleppt), Chile (eingeschleppt), Osterinseln (eingeschleppt), Israel (eingeschleppt), Japan (eingeschleppt), Neuseeland (eingeschleppt), Spanien (eingeschleppt), Uruguay und USA (eingeschleppt). Als Wirtspflanzen werden von ihm genannt: Apium graveolens L. und Daucus carota L. (Apiaceae); Brassica rapa L., B. oleracea L. und Corono-pus didymus (L.) Smith (Brassicaceae); Rumex altissimus Wood (Polygonaceae); Nicotiana tabacum L. und Solanum tuberosum L. (Solanaceae); und Stellaria spp. (Caryophyllaceae).
LITERATUR: [Morrone 2011]
HABITUS: [Fig. 76.30]
AEDOEAGUS: [Fig. 76.31]
KANARISCHE INSELN (Lista/2009): La Palma - Tenerife - Fuerteventura - Lanzarote
LA GOMERA: [Fig. 76.32]
1 Ex.: Valle Gran Rey, La Calera, 28° 05’41”N 17°20’15”, 26 m, beaten from Chenopodium murale L. together with Lixus brevirostris, 5.3.2012, leg. Krátký
HABITUS: [Fig. 76.33]
AEDOEAGUS: [Fig. 76.34]
KANARISCHE INSELN (Lista/2009): El Hierro - La Gomera - Gran Canaria - Fuerteventura
LA GOMERA: [Fig. 76.35]
17 Ex.: Arure, Ermita Virgen de La Salud, Artemisia canariensis (= A. thuscula), 28° 7'59"N 17°19'10"W, 817 m, 24.12.2011 & 2.3.2012, leg. Stüben
Kommentar: In meinem Katalog zu La Gomera [Stüben 2011c] wurden irrtümlicherweise nicht Habitus und Aedoeagus von Lixus pinkeri abgebildet, sondern eine mir bisher unbekannte Art von Gran Canaria vorgestellt. Das ergab ein Vergeich mit der Type von Lixus pinkeri Voss aus dem „Zoologischen Institut und Zoologischen Museum der Universität Hamburg“. Die Abbildungen hier geben Lixus pinkeri Voss, 1965, richtig wieder.
HABITAT: [Fig. 76.36]
HABITUS: [Fig. 76.37]
AEDOEAGUS: [Fig. 76.38]
KANARISCHE INSELN (Lista/2009): La Palma - La Gomera - Tenerife
LA GOMERA: [Fig. 76.39]
1 Ex.: La Palmita, Verbascum virgatum, 28°10'23"N 17°12'52"W, 643 m, 7.3.2012, leg. Stüben
1 Ex.: Bosque del Cedro, 28R28194 311309, 28°7'31.57"N, 17°13'12.25"W, Scrophularia sp., beaten, 945m, 13.04.1975
3 Ex.: El Bailadero (El Cedro), 28R28282 311291, 28°7'26.25"N, 17°12'39.89"W, Scrophularia sp., beaten, 985m, 03.07.1995, leg. Oromí
1 Ex.: El Cedro (no more precision), Scrophularia sp., 08.04.1967, leg. Palm
3 Ex.: Los Noruegos, 28R28054 311106, 28°6'24.82"N, 17°14'2.16"W, Scrophularia sp., beaten, 15.02.2003, leg. Oromí
Kommentar: In meinem Katalog zu La Gomera [Stüben 2011c] wurde irrtümlicherweise nicht Habitus und Aedoeagus von Cionus variegatus (Brullé, 1839), sondern von Cionus griseus Lindberg, 1958, eine endemische Art von Tenerife, abgebildet. Die Abbildungen müssen durch die hier erstmalig vorgestellten ersetzt werden.
HABITAT: [Fig. 76.40]
HABITUS: [Fig. 76.41]
AEDOEAGUS: [Fig. 76.42]
LA GOMERA: [Fig. 76.43]
3 Ex.: Arure, Ermita Virgen de La Salud, Melilotus officinalis , 28° 7'59"N 17°19'10"W, 817 m, 2.3.2012, leg. Stüben
HABITAT: [Fig. 76.44]
HABITUS: [Fig. 76.45]
LA GOMERA: [Fig. 76.46]
1 Ex.: N Epina: Teselinde, Santa Clara, Laurisilva, Silene bourgeaui, 28°11'47"N 17°17'16"W, 748 m, 10.3.2012, leg. Stüben
Kommentar: Bei dem am 10.3.2012 gefundenen Weibchen handelt es sich wahrscheinlich um eine neue Art, die mir seit dem Fund eines weiteren Pärchens im Jahr 2011 ebenfalls nördlich von Epina (Teselinde, Santa Clara) bekannt ist und in den nächsten Monaten von mir beschrieben wird.
(*) Weitere Meldungen und Ergebnisse, die uns in den nächsten Wochen und Monaten von den gemeinsamen Exkursionen während des Meetings auf La Gomera erreichen, finden Einlass in den geplanten Makaronesien-Katalog unserer Internetzeitschrift „Le Charancon“ [Stüben, Behne & Brunner 2013].
Wir sehen also, es gibt noch sehr viel auf La Gomera zu entdecken. Das haben auch die vielen Neubeschreibungen in den letzten Jahren gezeigt! Mit der Biologischen Station des CURCULIO-Instituts haben wir die Voraussetzung geschaffen (und stehen hier noch ganz am Anfang!), um die Curculioniden La Gomeras und der Nachbarinseln noch besser studieren zu können und möglichst viele Wissenschaftler aus ganz Europa an diesen Entdeckungen teilnehmen zu lassen.
Daher möchte ich an dieser Stelle nochmals Wissenschaftler und Diplomanden einladen, in unserer Forschungseinrichtung für 3 – 6 Monate zu arbeiten:

In enger Kooperation mit der "Casa Diversa" auf La Gomera / Hermigua (www.casadiversa.com) und den Museen, Universitäten und Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland sucht das CURCULIO-Institut (www.curci.de) Diplomanden, die 3-6 Monate (oder länger) in der Biologischen Station des CURCI arbeiten möchten.
Arbeitsgebiet: Erforschung der Curculionoidea (Coleoptera) auf La Gomera. Von populationsgenetischen Untersuchungen, über phylogenetisch-systematisch-taxonomische Arbeiten bis hin zu biologisch-ökologischen Studien ist jedes Thema willkommen. Um ein effektives Arbeiten in der Biologischen Station zu ermöglichen und Synergien zu erzielen, ist jedoch im Vorfeld eine enge thematische Absprache empfehlenswert.
Unverzichtbare Sammel- und Arbeitsgenehmigungen für ganz La Gomera (inkl. "NP Garajonay") werden den Mitarbeitern / Mitgliedern des CURCULIO-Instituts zur Verfügung gestellt. Ebenso können Diplomanden auf ein Labor (z.B. mit Mikroskopen, Curculionoidea-Vergleichssammlung, PC und Internet) zurückgreifen. - Sie finden also ideale Arbeitsbedingungen vor!
Voraussetzungen: Hohes Engagement im Naturschutz, elementare Spanisch-Kenntnisse (empfehlenswert). Es wird die Bereitschaft erwartet, gelegentlich vor Interessenten in der "Casa Diversa" über die eigene Arbeit zu berichten (Dolmetscher vorhanden) und/oder Interessenten mit auf die ein oder andere Exkursionen zu nehmen.
Kontakt: Falls Interesse besteht, setzen Sie sich bitte gleich mit dem Leiter der Biologischen Forschungsstation Dr. Peter E. Stüben / CURCULIO-Institut in Verbindung: P.Stueben@t-online.de
Zögern Sie nicht - Fragen kostet schließlich nichts. Vielen Dank!
Anschrift: CURCULIO-Institute Dr. Peter E. Stüben, Hauweg 62, 41066 Mönchengladbach, Germany, E-Mail: P.Stueben@t-online.de

Ursula Baur (Germany), Christoph Bayer (Germany), Lutz Behne (Germany), Norbert Bewernitz (Germany), Johannes Brunner (Germany), Marion Brunner (Germany), Jiri Krátký (Czech Rep.), Manfred Lehmann (Germany), Jean-Michel Lemaire (France), Antonio Machado (Spain: Canary Islands), Raquel Marcos (Spain), Jochen Messutat (Germany), Gerd Müller (Germany), Uschi Müller (Germany), Jean Pelletier (France), Philippe Ponel (France), Peter Sprick (Germany), Robert Stejskal (Czech Rep.), Peter E. Stüben (Germany), Filip Trnka (Czech Rep.), Patrick Weill (France).
Neben den schon genannten Institution auf La Gomera gilt unser ganz besonderer Dank Antonio Machado, der während des Meetings für die entsprechende PR-Arbeit gesorgt hat, und Raquel Marcos & Norbert Bewernitz von der Casa Diversa in Hermigua (Las Nuevitas), die als perfekte Gastgeber der Biologischen Station des CURCULIO Instituts mit für einen reibungslosen Ablauf während der Veranstaltungen gesorgt haben. Den vielen spanischen und deutschen Freunden in Hermigua gilt ebenfalls mein Dank.
Morrone, J.J. (2011): Annotated checklist of the tribe Listroderini (Coleoptera: Curculionidae: Cyclominae). - Zootaxa 3119: 1-68.
Stüben, P.E. (2011a): Discurso de inauguración de la 1ª Estación Biológica del Instituto CURCULIO en la Gomera, el 18-12-2010. (Coleoptera: Curculionoidea) - German/Spanish. - Weevil News: http://www.curci.de, 61: 4 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
Stüben, P.E. (2011b): Eröffnungsrede der 1. Biologischen Station des CURCULIO-Instituts auf La Gomera am 18.12.2010. (Coleoptera: Curculionoidea). - German. - Weevil News: http://www.curci.de, 62: 4 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
Stüben, P.E. (2011c): Die Curculionoidea (Coleoptera) La Gomeras - SNUDEBILLER 12, Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea, Mönchengladbach: CURCULIO-Institute: 85-129.
Stüben, P.E. / Behne, L. / Floren, A. / Günther, H. / Klopfstein, S. / López, H. / Machado, A. / Schwarz, M. / Wägele, J.W. / Wunderlich, J. & Astrin, J.J. (2010): Canopy Fogging in the Canarian laurel forest of Tenerife and La Gomera. - WEEVIL NEWS: http://www.curci.de/Inhalt & WEEVIL NEWS (printable version) 51 (1. May 2010): 21 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
HABITUS: [Fig. MECcir.1]
AEDOEAGUS: [Fig. MECcir.2]
KANARISCHE INSELN (Lista/2009): Tenerife
LA GOMERA: [Fig. MECcir.Map]
2 Ex.: E Hermigua, PN Majona: near Casas del Palmar, 28°9'44"N, 17°10'00"W, Plantago, beaten, 321m, 06.02.2011, leg. Stüben
7 Ex.: La Caleta - Punta San Lorenzo, 28°10'15"N, 17°9'38"W, Plantago, beaten, 41m, 25.02.2011, leg. Stüben
1 Ex.: E Hermigua, PN Majona: El Palmar - Taguluche, Sukkulentenbusch, Plantago, 28°9'45"N 17°10'01"W, 322 m, 31.12.2011, leg. Stüben
2. Im Katalog zu La Gomera [Stüben 2011c: 113] wurden irrtümlicherweise nicht Habitus und Aedoeagus von Cionus variegatus (Brullé, 1839), sondern von der einfarbig gelb beschuppten Art Cionus griseus Lindberg, 1958, einer endemischen Art von Tenerife, abgebildet. Die Abbildungen müssen durch die oben unter Cionus variegatus bereitgestellten Abbildungen ersetzt werden.
3. In meinem Katalog zu La Gomera [Stüben 2011c: 125] wurden irrtümlicherweise nicht Habitus und Aedoeagus von Lixus pinkeri abgebildet, sondern eine mir bisher unbekannte Art von Gran Canaria vorgestellt. Das ergab ein Vergeich mit der Type von Lixus pinkeri Voss aus dem „Zoologischen Institut und Zoologischen Museum der Universität Hamburg“. Die Abbildungen hier geben Lixus pinkeri Voss, 1965, richtig wieder.
Das sehr schöne Poster zum Meeting mit allen 125 Arten (aktueller Stand: August 2012!) kann für 79,- Euro (incl. Porto) direkt beim CURCULIO-Institut bestellt werden. Druck und Auslieferung nach Eingang der Bestellungen ab Anfang 2013!
[TV Canarias]